Das Gehirn: Ein Apparat mit dem wir denken, das wir denken.
- Armin Wick
- 29. Dez. 2025
- 1 Min. Lesezeit

Manchmal steht dieser Satz einfach da.
Wie auf einem Teebeutel.
Ohne Nachfrage.
Das Gehirn.
Ein Apparat.
Nichts Poetisches. Und doch bewegt sich etwas.
Im Alltag sitzt man vielleicht einen Moment still.
Zwischen zwei Aufgaben.
Der Kaffee wird kalt.
Gedanken laufen weiter.
Da ist ein Plan.
Ein Zweifel.
Eine Erinnerung, die sich nicht angekündigt hat.
Und irgendwo darin dieses Denken.
So selbstverständlich.
So lautlos.
Beobachtung:
Gedanken kommen.
Gedanken gehen.
Der Körper bleibt sitzen.
Der Raum bleibt ruhig.
Nichts drängt.
Manchmal fühlt es sich an, als würde etwas denken,
bevor „ich“ überhaupt da bin.
Manchmal fühlt es sich sehr persönlich an.
Und beides darf gleichzeitig wahr sein.
Das Gehirn arbeitet.
Wie immer.
Auch wenn man müde ist.
Auch wenn man nichts lösen will.
Vielleicht liegt darin eine kleine Entlastung.
Vielleicht auch eine Irritation.
Beides hat Platz.
Ein Gedanke denkt den nächsten.
Und irgendwo schaut jemand zu.
Oder auch nicht.
Was genau passiert eigentlich,
wenn ein Gedanke bemerkt wird?
Wo bist du in dem Moment,
in dem du merkst, dass du denkst?
Und was geschieht,
wenn du für einen Augenblick nichts klärst?
Der Satz bleibt stehen.
Wie der Teebeutel im heißen Wasser.
Er zieht.
Oder auch nicht.

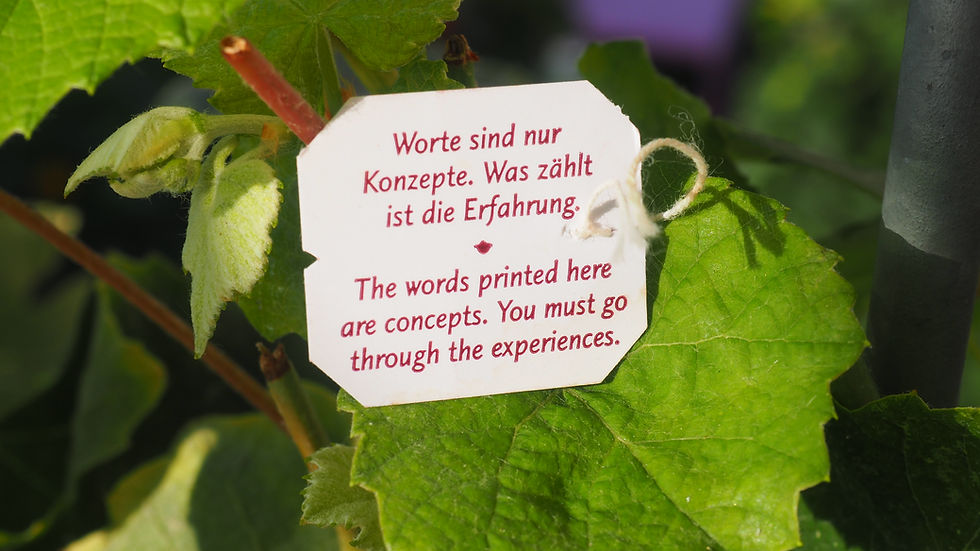
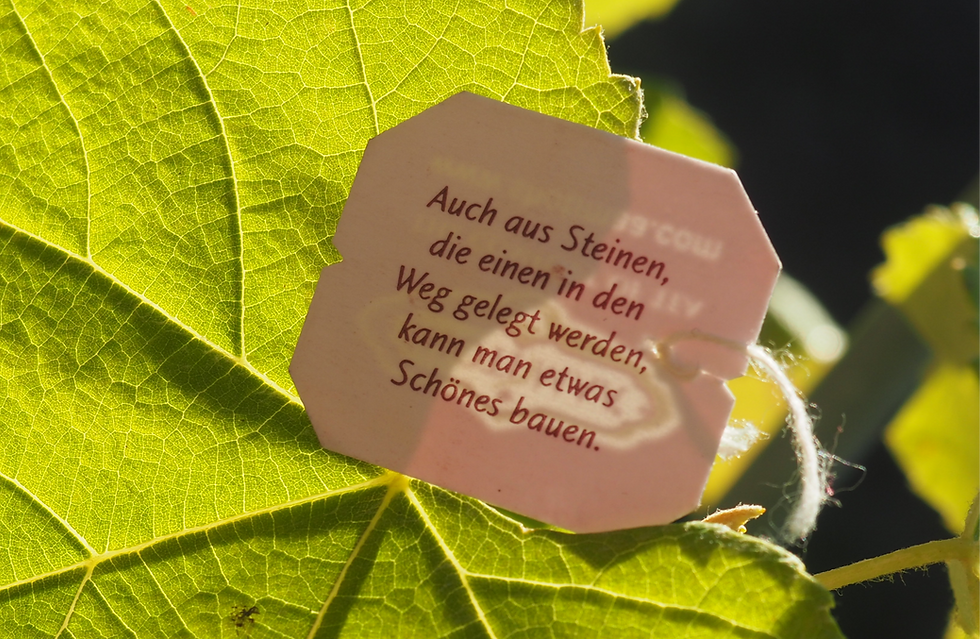
Kommentare